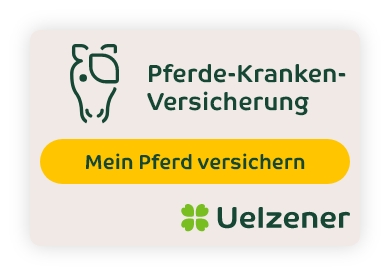Läuft das Pferd nicht mehr rund, wirkt steif oder stolpert häufiger, kann das sogenannte Hufrollen-Syndrom dahinterstecken. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung im Bereich der Hufe, die vor allem bei Reitpferden vorkommt und neben der Arthrose eine der häufigsten Ursachen für Lahmheit ist. Häufig liegt eine chronische Entzündung zugrunde, die im weiteren Verlauf zu einer Schädigung aller am Hufrollenkomplex beteiligten Strukturen führt. Dazu gehören der Hufschleimbeutel, die tiefe Beugesehne, das Strahlbein und dazugehörige Bänder.
Das Hufrollen-Syndrom ist für betroffene Tiere sehr schmerzhaft und schränkt sie in ihrer Bewegungsfreiheit stark ein. Es ist zwar nicht heilbar, mithilfe geeigneter Therapiemaßnahmen lassen sich die Symptome jedoch gut in den Griff kriegen, so dass das Pferd im besten Fall wieder reitbar ist. Voraussetzung dafür ist jedoch eine frühzeitige Diagnose. In unserem Artikel erfährst du, woran du das Hufrollen-Syndrom erkennst und was du tun kannst, falls dein Pferd daran erkrankt.
Was ist das Hufrollen-Syndrom?
Um zu verstehen, was sich hinter dem Hufrollen-Syndrom verbirgt, muss man sich zunächst mit der Anatomie des Pferdehufs beschäftigen. Die Hufrolle bezeichnet einen Strukturkomplex im unteren Bereich des Pferdebeins. Sie ist sowohl an den Vorder- als auch an den Hintergliedmaßen zu finden und wird aus der unteren Gelenkfläche des knöchernen Strahlbeins, dessen Bandapparat, dem Hufschleimbeutel und der tiefen Beugesehne gebildet. Die Funktion der Hufrolle besteht darin, das Gewicht des Pferdes beim Laufen aufzunehmen und abzufedern. Sie wirkt also wie eine Art Stoßdämpfer. Ist die Hufrolle entzündet oder gereizt, geht das beim Auftreten und vor allem beim Abrollen mit erheblichen Schmerzen einher. Um dem entgegenzuwirken, läuft das Pferd mehr auf den Zehen (vorderer Hufbereich) statt auf den Trachten (hinterer Hufbereich). Das kann jedoch dazu führen, dass sich der Huf im weiteren Verlauf verformt. Da dem Hufrollen-Syndrom meist eine chronische Entzündung (fachsprachlich: Podochlorose) zugrunde liegt, sind auch die inneren Strukturen gefährdet. Mit der Zeit fasert die tiefe Beugesehne in stark belasteten Bereichen aus und der Hufschleimbeutel entzündet sich, was abermals Schmerzen verursacht. Auch am Strahlbein kommt es zu strukturellen Veränderungen. Bleibt eine medizinische Behandlung aus, wird es porös und bricht schlimmstenfalls ein, was dann in einer hochgradigen Lahmheit resultiert.
Ursachen des Hufrollen-Syndroms
Was genau das Hufrollen-Syndrom verursacht, ist bislang nicht sicher geklärt. Auffällig ist, dass die Erkrankung nur bei domestizierten Pferden und insbesondere bei Reitpferden vorkommt. Bei Wildpferden ist sie bislang nicht festgestellt worden. Das legt nahe, dass die Erkrankung in irgendeiner Weise durch den Menschen verschuldet ist.
Hier ein Überblick über mögliche Ursachen, die aktuell diskutiert werden:
- Genetische Prädisposition: Möglicherweise gibt es bei Pferden eine genetische Veranlagung für das Hufrollen-Syndrom, die durch die Zucht weitergegeben worden ist. Die Annahme findet dadurch Unterstützung, dass bei unbeschlagenen und unberittenen Pferden mit vorerkrankten Eltern Veränderungen am Strahlbein festgestellt werden konnten.
- Überlastung des Bewegungsapparats: Im Reitsport ist der Bewegungsapparat des Pferdes einer besonders großen Belastung ausgesetzt – sei es durch enge Wendungen, schnelle Drehungen, abrupte Stopps oder die enormen Kräfte, die beim Springen und Landen wirken. Auch das Training auf zu harten Böden ist nicht gut für die Gliedmaßen.
- Falsche Hufbearbeitung: Eine fehlerhafte oder unregelmäßige Hufbearbeitung sowie schlechte Beschläge können dazu führen, dass sich der Pferdefuß in der Stellung verändert und falsch beansprucht wird. Sind die Hufeisen zu eng, wirken die Erschütterungen beim Laufen und Springen direkt auf die Gelenke. All das kann letztlich in einer Hufrollenentzündung resultieren.
- Zu frühes Anreiten: Wird ein Pferd zu früh oder zu intensiv angeritten, können später Erkrankungen der Hufrolle die Folge sein. Das liegt darin begründet, dass die Strukturen junger Pferde noch nicht vollständig ausgebildet und dadurch nicht in dem Umfang belastbar sind wie bei erwachsenen Tieren.
- Bewegungsmangel: Umgekehrt kann ein Bewegungsmangel während der Aufzucht ursächlich für das Hufrollen-Syndrom sein. Denn: Bewegung ist wichtig, um Knochen, Gelenke und Sehnen zu stärken, stützende Muskulatur auszubilden und die Durchblutung zu fördern, damit die inneren Strukturen ausreichend versorgt werden.
- Fehlstellungen: Fehlstellungen können angeboren sein, sich aber auch erst durch fehlende Bewegung oder falsche Beanspruchung entwickeln. Werden sie nicht rechtzeitig korrigiert, steigt das Risiko, dass die Hufrolle überlastet und sich entzündet.
- Trauma: Auch durch Traumata kann ein Hufrollen-Syndrom ausgelöst werden. Schläge, Stürze oder Tritte können Schäden an den inneren Strukturen verursachen und zu lokalen Entzündungen oder Schwellungen führen, wodurch sich die Belastungsverhältnisse in der Hufrolle ändern. Auch Mikroverletzungen wie kleine Risse oder Knorpelschäden können langfristig die Funktion der Hufrolle beeinträchtigen.
Zwar sind die Ursachen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sicher definiert, klar ist jedoch, dass sich falsche Belastungen, fehlende Bewegung, akute Verletzungen und dergleichen negativ auf den Bewegungsapparat eines Pferdes auswirken. Umso wichtiger ist es, die Tiere von klein auf artgerecht zu halten, richtig zu pflegen und im Training verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen, um das Risiko eines Hufrollen-Syndroms möglichst gering zu halten.
Hufrollen-Syndrom erkennen: Das sind die Symptome
Die Symptome des Hufrollen-Syndroms können je nach Schweregrad unterschiedlich ausgeprägt sein. Zu Beginn sind sie häufig unspezifisch, was eine Einordnung erschwert. Hinzu kommt, dass das Hufrollen-Syndrom bei Reitpferden in den meisten Fällen beide Vorderbeine betrifft. Dadurch kann es passieren, dass Auffälligkeiten beim Laufen fälschlicherweise auf Probleme im Schulterbereich statt im Huf zurückgeführt werden. Wir geben einen Überblick über Anzeichen, die auf ein Hufrollen-Syndrom hinweisen können.
- Klammer, lahmender Gang
- Häufiges Stolpern
- Zögerliches Auffußen, Landen auf der Zehe
- Taktunreines Laufen bei Wendungen
- Schwierigkeiten beim Longieren
- Steifheit nach dem Verlassen der Box
- Zunehmende Bewegungsunlust
- Herausstellen eines Beins zur Entlastung
- Verformungen des Hufs (Trachtenzwang)
- Andauernde Lahmheit
Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass das Pferd Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen hat, sollte umgehend tierärztlicher Rat eingeholt werden. Es ist wichtig, die Ursache medizinisch abzuklären, um zu verhindern, dass sich der Zustand verschlimmert, und um das Wohlbefinden des Tiers wiederherzustellen.
Hufrollen-Syndrom beim Pferd diagnostizieren
Das Hufrollen-Syndrom kann nur durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin sicher diagnostiziert werden. Den ersten Schritt bilden eine Anamnese und eine Allgemeinuntersuchung. Anschließend erfolgt eine Lahmheitsuntersuchung, bei der das Gangbild des Pferdes analysiert und Beugeproben durchgeführt werden. Eine wichtige Maßnahme ist die sogenannte Leitungsanästhesie. Dabei wird der Hufrollenbereich, der betroffen zu sein scheint, betäubt. Wenn das Pferd infolgedessen normal läuft und keine Anzeichen von Lahmheit zeigt, ist das ein starker Hinweis auf eine Hufrollenentzündung.
Der Lahmheitsuntersuchung schließen sich bildgebende Verfahren (Röntgen, Ultraschall oder MRT) an, um Unregelmäßigkeiten oder Veränderungen an den innenliegenden Strukturen ausfindig zu machen. Beim Röntgen wird eine sogenannte Oxspring-Aufnahme angefertigt. Hier positioniert man den Huf in einem bestimmten Winkel, damit das Strahlbein und die tiefe Beugesehne optimal dargestellt werden können. Nicht immer lässt sich das Stadium der Erkrankung anhand eines Röntgenbilds gut einschätzen. In solchen Fällen kann eine MRT sinnvoller sein. Mitunter ist auch eine Punktion zur Untersuchung der Gelenkflüssigkeit oder eine Endoskopie erforderlich.
Behandlungsmöglichkeiten des Hufrollen-Syndroms
Das Hufrollen-Syndrom ist nicht heilbar, allerdings lassen sich die Symptome medizinisch gut in den Griff bekommen, so dass sich das Pferd normal und schmerzfrei bewegen und im Idealfall wieder geritten werden kann. Die Behandlung basiert üblicherweise auf einer Kombination aus Medikamenten, orthopädischen Maßnahmen und einer Ruhestellung des Hufs. Wie aufwendig die Medikation ist, hängt vom Schweregrad der Erkrankung ab. Bei leichter Ausprägung kann bereits die orale Gabe von Schmerzmitteln und Entzündungshemmern helfen. Bei schweren Verläufen kann es notwendig sein, die Wirkstoffe (oft Kortison) direkt ins Gelenk zu injizieren. Mitunter werden auch Knochenaufbaupräparate oder durchblutungsfördernde Mittel verabreicht, damit die betroffenen Bereiche alle wichtigen Nährstoffe erhalten und besser regenerieren. Wenn sich Knorpel abgerieben hat, können die Überreste mithilfe einer Spülung entfernt werden. Das ist allerdings nur unter Narkose möglich. Um das Gelenk wieder aufzubauen und neues Gewebe zu bilden, können Methoden der Stammzellen- oder Stoßwellentherapie herangezogen werden.
Mindestens ebenso wichtig wie die Medikation ist ein orthopädischer Hufbeschlag. Er hilft, den Huf zu entlasten, Fehlstellungen oder Verformungen zu korrigieren und dem Tier ein schmerzfreies Auftreten zu ermöglichen. Die Trachten werden dabei mithilfe von Einlagen stoßdämpfend gepolstert und gestützt, so dass das Abrollen über die Zehen leichter fällt.
In der Regenerationsphase sollte das Pferd nach Möglichkeit geschont werden. In dem Zusammenhang gilt es, Ruhezeiten einzuhalten und den Trainingsplan an den Gesundheitszustand anzupassen. Bewegung ist weiterhin wichtig, um die Durchblutung des Hufs aufrechtzuerhalten, aber in moderatem Maß. Wenn sich das Tier erholt, kann auch das Training allmählich gesteigert werden. Begleitend sind regelmäßige tierärztliche Kontrollen sehr wichtig, um Fortschritte, aber auch Rückschritte nachvollziehen zu können und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Eine Pferdekrankenversicherung leistet in dem Zusammenhang gute Dienste. Sie schützt vor hohen Tierarztkosten, so dass das Pferd zu jedem Zeitpunkt optimal behandelt werden kann.
Hufrollen-Syndrom vorbeugen
Zwar werden die konkreten Ursachen für das Hufrollen-Syndrom derzeit noch diskutiert, unstrittig ist jedoch, dass sich das Risiko einer Erkrankung reduzieren lässt, wenn korrekt mit dem Pferd umgegangen wird. In dem Zusammenhang spielen folgende Aspekte eine Rolle:
- Korrekte Hufbearbeitung: Nur wenn ein Huf anatomisch korrekt geformt und richtig beschlagen ist, kann er der Belastung, die sich durch das Gewicht und die Bewegung des Pferdes ergibt, standhalten.
- Ausreichend Bewegung: Ausreichend Bewegung ist wichtig, um die Durchblutung im Huf anzuregen und Muskulatur, Sehnen, Bänder und Gelenke zu stärken.
- Warm-up und Cool-down: Aufwärmen vor jedem Training ist das A und O, um den Bewegungsapparat auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten. Schon 15 bis 20 Minuten im Schritt reichen dafür aus. Umgekehrt sollte sich das Pferd auch nach dem Training eine Zeit lang bewegen, um langsam wieder herunterzufahren.
- Schonendes Anreiten: Jungpferde sollten langsam angeritten werden, damit der Körper Zeit hat, sich an die Belastung zu gewöhnen.
- Überlastung meiden: Schnelle Gangarten wie das Galopp, enge Wendungen, Sprünge und harte Stopps sind sehr strapaziös für den Bewegungsapparat und können die Entstehung eines Hufrollen-Syndroms begünstigen. Aus diesem Grund ist es besser, darauf zu verzichten.
- Weiche Böden: Weiche Böden sind schonender für die Gelenke. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, wenigstens die Trainingseinheiten auf weichen Untergründen zu absolvieren.
- Gesunde Ernährung: Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist essenziell für einen normal funktionierenden Bewegungsapparat. Die Nährstoffzusammensetzung des Futters muss auf die Bedürfnisse des Pferdes abgestimmt sein – vor allem, wenn das Tier noch im Wachstum ist.
Grundsätzlich sollte das Trainingslevel immer auf die Konstitution des Tieres abgestimmt sein. Bei Anzeichen von Überanstrengung und Stress ist es wichtig, dem Pferd Ruhe und Erholung zu ermöglichen, damit es sich regenerieren kann. Eine körperliche Dauerbeanspruchung kann nämlich nicht nur zu einer Hufrollenerkrankung führen, sondern viele weitere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen.
Fazit
Das Hufrollen-Syndrom ist eine der häufigsten Lahmheitsursachen bei Reitpferden und kann Tier und Mensch gleichermaßen vor Herausforderungen stellen. In erster Linie kommt es auf eine artgerechte Haltung und den richtigen Umgang mit dem Pferd an, um das Risiko einer Erkrankung zu reduzieren. Dazu zählen regelmäßige Vorsorgemaßnahmen, die richtige Pflege und Ernährung sowie ausreichend Bewegung bei ausgewogener Belastung. Je früher das Hufrollen-Syndrom erkannt wird, desto besser stehen die Erfolgsaussichten und desto wahrscheinlicher ist es, dass das Pferd wieder ein normales Leben ohne Schmerzen und Beeinträchtigungen führen kann.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Thema Hufrollen-Syndrom beim Pferd
Helfen Physiotherapie oder gezieltes Bewegungstraining beim Hufrollen-Syndrom?
Ja. Schonendes Training und physiotherapeutische Maßnahmen können die Muskulatur stärken, was dabei hilft, die Hufrolle zu entlasten.
Kann bei einem Hufrollenbefund operiert werden?
Ja, bei einem Hufrollenbefund besteht die Möglichkeit, eine Neurotektomie durchzuführen, also bestimmte Nerven zu durchtrennen, damit das Schmerzsignal nicht weitergeleitet wird. Heute macht man das allerdings nicht mehr so häufig wie früher. Grund dafür ist, dass das Pferd einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt ist, da es durch das fehlende Empfinden im Huf schneller stolpern oder stürzen kann. Bei Turnierpferden gilt der Eingriff zudem als Doping, wodurch sie nicht mehr an Wettbewerben teilnehmen dürfen.
Gibt es Zusammenhänge zwischen Fütterung und Hufrollen-Syndrom?
Ein gesundes und ausgewogenes Futter ist wichtig für die Ausbildung und den Erhalt von Knochen, Sehnen und Gelenken. Eine falsche Ernährung kann das Risiko einer Erkrankung erhöhen, etwa wenn es nicht genug Nährstoffe liefert (Unterversorgung) oder zu viele Kalorien enthält (Übergewicht).
Können Pferde mit Hufrollen-Syndrom noch auf die Weide?
Ja. Ist das Pferd in Behandlung und muss es geschont werden, ist ein Weidegang eine gute Möglichkeit, dem Tier Bewegung zu bieten, ohne es zu überlasten.