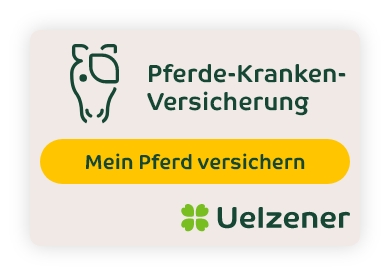Ein glänzendes, gesundes Fell ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein Indikator dafür, dass es dem Pferd gesundheitlich gut geht. Treten jedoch plötzlich kahle, schuppige oder verkrustete Stellen auf, kann das auf eine Pilzerkrankung hinweisen. Der folgende Artikel erklärt, wie man Hautpilz erkennt, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie man einem Befall effektiv vorbeugen kann.
Charakteristika: Woran erkenne ich Hautpilz bei meinem Pferd?
Besonders zur Fellwechselzeit und bei starken Wetterumschwüngen haben viele Pferde mit Hautpilzerkrankungen, fachsprachlich Dermatomykose genannt, zu kämpfen. Besonders anfällig sind ältere, sehr junge und immungeschwächte Pferde.
Zu den häufigsten Auslösern zählen die Pilzarten Trichophyton und Microsporum. Als Dermatophyten befallen sie vor allem die oberste Hautschicht und führen zu Fellveränderungen. Zu den typischen Merkmalen zählen:
- Rundliche, kahle Stellen, die in Größe und Anzahl variieren können
- Stellenweise gesträubte Haare
- Schuppige, verkrustete Hautbereiche, die durch abgestorbene Hautzellen entstehen
- Gerötete und manchmal blutige Scheuerstellen
- Kleine Schwellungen
- Juckreiz und eine daraus entstehende Entzündung an der Haut
Der Hautpilz bevorzugt eine warme und feuchte Umgebung. Dort bietet sich ihm der ideale Nährboden. Er fühlt sich daher besonders in Arealen wohl, in denen Pferde viel schwitzen. Häufig breitet sich ein Hautpilz daher in der Sattel- und Gurtlage sowie im Achsel- und Schulterbereich des Pferdes aus. Auch am Kopf, insbesondere im Bereich, wo Trense und Halfter aufliegen, ist häufig ein Befall erkennbar.
Mögliche Ursachen von Hautpilz bei Pferden
Alle Pferde tragen Pilzsporen auf der Haut und im Fell. Ob sich daraus jedoch eine Hautpilzerkrankung entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist nicht unbedingt eine Frage mangelnder Hygiene oder Pflege. Tatsächlich kann sogar die Nutzung von zu viel oder falschen Pflegeprodukten wie Shampoo eine Pilzinfektion begünstigen, da so das natürliche Gleichgewicht der Haut gestört werden kann.
Weitere mögliche Faktoren für die Entstehung einer Hautpilzerkrankung sind:
- Ein geschwächtes Immunsystem, beispielsweise durch Vorerkrankungen, Mangelernährung oder übermäßigen Stress
- Eine feuchte, warme und ungenügend saubere Umgebung, die somit optimale Bedingungen für das Pilzwachstum bietet
- Hautverletzungen oder Parasiten wie Milben, durch die Pilzsporen leichter in die Pferdehaut eindringen können
- Saisonale Faktoren, wie Feuchtigkeit durch Regen und Schnee oder vermehrte Schweißbildung durch Hitze
Nicht zuletzt ist die Virulenz, also die krankmachenden Eigenschaften der spezifischen Pilzart, entscheidend, ob und in welchem Ausmaß die Erkrankung ausbricht.
Hochansteckend: Übertragung von Hautpilz
Die Übertragung von Hautpilz kann durch den direkten Kontakt mit infizierten Pferden oder Menschen erfolgen, selbst wenn diese keine Symptome zeigen. Des Weiteren können sich Pferde indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Decken, Putz- und Sattelzeug anstecken. Auch Stallwände oder Futtertröge können Sporen enthalten und sogar über die Luft ist eine Übertragung möglich.
Um die Verbreitung des Hautpilzes innerhalb des Stalls oder der Herde bestmöglich einzudämmen, ist es wichtig, betroffene Pferde schnell zu isolieren und kontaminierte Gegenstände zu desinfizieren. Zu beachten ist, dass Pferde die Erreger auch übertragen können, wenn die Symptome bereits abgeklungen sind.
So wird Hautpilz bei Pferden diagnostiziert
Der Hautpilz wird meist durch eine äußere Untersuchung diagnostiziert. Zur Absicherung kann ein Hautgeschabsel im Labor auf Pilzsporen untersucht werden. Diese Untersuchungen helfen auch, Hautpilz von anderen Erkrankungen wie Milbenbefall oder Ekzemen abzugrenzen, deren Symptomatik ähnlich sein kann.
Um sich vor hohen Kosten für diagnostische Verfahren und Heilbehandlungen zu schützen, lohnt sich der Abschluss einer Krankenversicherung für Pferde. So kann dem vierbeinigen Liebling im Ernstfall bestmöglich geholfen werden, ohne sich Sorgen um finanzielle Risiken machen zu müssen.
Behandlung einer Hautpilzerkrankung
Hautpilz verbreitet sich leicht. Hinzu kommt, dass durch die offenen Hautstellen Bakterien eindringen und eine Sekundärinfektion auslösen können. Eine schnelle Behandlung ist daher essentiell. Zwar kann eine Pilzinfektion auch von alleine abklingen, jedoch ist der Heilungsprozess ohne therapeutische Mittel langwierig und kann in schweren Fällen mehrere Monate andauern. Unzureichend behandelt kann Hautpilz zudem zu weiteren Problemen führen. Es kann unter Umständen festes Narbengewebe entstehen, das so stark in der Bewegung spannt, dass das Pferd zu lahmen beginnt.
Eine medizinische Behandlung dauert in der Regel wenige Wochen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.
- Äußerliche Behandlung: Es kann hilfreich sein, das Pferd mit einer speziellen antimykotischen Waschlotion zu waschen. Bestenfalls führst du diese Behandlung am gesamten Pferdekörper durch. Steht im Winter kein Solarium zum Trocknen zur Verfügung, sollten mindestens die betroffenen Stellen gewaschen werden. Alternativ kann auch Obstessig im Verhältnis 1:2 mit Wasser gemischt Abhilfe schaffen. Diese Lösung solltest du alle zwei bis drei Tage auf die betroffenen Stellen geben. Jedoch empfiehlt sich diese Behandlung nur, solange sich keine Krusten gebildet haben.
- Innerliche Behandlung: Spezielle vorbeugende Pilzimpfungen können den Ausbruch der Infektion zwar nicht verhindern, aber deren Verlauf mildern und die Heilung beschleunigen. Ein gut funktionierendes Immunsystem trägt darüber hinaus einen wichtigen Teil zum Heilungsprozess bei. Vitaminpräparate und Ergänzungsfutter können die Abwehrkräfte stärken, wenn sie auf die Bedürfnisse des Pferdes angepasst werden.
Welche Behandlungsmethode sich am besten für den Vierbeiner eignet, sollte stets in Abstimmung mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin entschieden werden. In einigen Fällen kann eine Kombination verschiedener Maßnahmen sinnvoll sein.
Pilzerkrankungen bei Pferden vorbeugen
Es gibt einige Tipps und Tricks, die unkompliziert im Alltag umsetzbar sind und helfen können, Hautpilz vorzubeugen. Dazu gehört die regelmäßige, gründliche Reinigung der Ausrüstung, um vorhandene Sporen zu entfernen. Die regelmäßige Desinfektion der Hände sowie des Putzzeugs ebenso von Bedeutung – vor allem nach einer Erkrankung.
Um eine optimale Nährstoffversorgung sicherzustellen und so das Immunsystem zu stärken, sollte hochwertiges Futter gefüttert und Heu und Stroh stets auf Feuchtigkeit und Schimmel untersucht werden. Die Vermeidung von Stress kann auch förderlich für das Immunsystem sein, weshalb eine ruhige Umgebung und eine Haltungsform mit genügend Auslauf sehr wichtig sind.
Fazit
Hautpilz kann für betroffene Pferde zwar unangenehm sein, ist aber mit den richtigen Maßnahmen gut behandelbar. Wichtig ist eine frühzeitige Erkennung der Symptome sowie eine konsequente Behandlung. Durch gezielte Hygienemaßnahmen und die Stärkung des Immunsystems lässt sich das Risiko eines Ausbruchs reduzieren. Wer aufmerksam auf Veränderungen von Haut und Fell achtet und bei Verdacht schnell handelt, schützt nicht nur das einzelne Tier, sondern die gesamte Herde.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Thema Hautpilz bei Pferden
Kann mein Pferd mehrmals an Hautpilz erkranken?
Ja, zwar sind kurierte Pferde einige Wochen bis Monate immun, jedoch schützt eine überstandene Infektion nicht automatisch vor einer erneuten Erkrankung.
Wie lange sind Pilzsporen in der Umgebung überlebensfähig?
Pilzsporen sind äußerst widerstandsfähig und können in der Umgebung, etwa in Decken, Bürsten oder an Stallwänden, mehrere Monate bis Jahre überdauern. Eine gründliche Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung und Umgebung des Pferdes sind daher entscheidend.
Wie kann ich Putzzeug und Decken wirksam desinfizieren?
Putzzeug aus Kunststoff kann mit heißem Wasser und einem fungiziden Desinfektionsmittel gereinigt werden. Textilien wie Decken oder Schabracken sollten möglichst heiß gewaschen und mit einem desinfizierenden Waschzusatz behandelt werden. Einige Reitbedarfshändler bieten auch spezielle Wasch- und Desinfektionsservices an.
Wie schnell nach der Infektion zeigen sich erste Symptome?
Nach dem Kontakt mit Pilzsporen kann es mehrere Tage bis Wochen dauern, bis sichtbare Symptome auftreten. In dieser Zeit kann das Pferd bereits andere Tiere oder Menschen anstecken, was die schnelle Isolation im Verdachtsfall umso wichtiger macht.