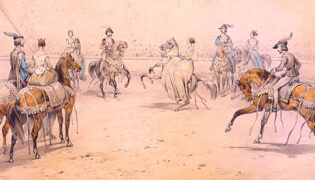Tumorerkrankungen bei Pferden sind keine Seltenheit. Auch wenn nicht alle Tumore bösartig sind, können sie gesundheitliche Probleme verursachen und das Wohlbefinden eines Pferdes erheblich beeinträchtigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, beispielsweise mithilfe einer Chemotherapie, Strahlentherapie, Immuntherapie oder mit einer Kombination verschiedener Methoden. Doch nicht immer sind diese Therapieformen erfolgversprechend. In vielen Fällen ist eine Operation der beste oder sogar einzige Weg, einen Tumor zu entfernen. In unserem Artikel geben wir dir einen Überblick, welche Tumorarten bei Pferden am häufigsten auftreten, wann ein chirurgischer Eingriff sinnvoll ist und wie Tierärztinnen und Tierärzte dabei vorgehen.
Bösartige und gutartige Tumore beim Pferd
Als Tumor bezeichnet man im engeren Sinne unkontrolliert wachsende Zellwucherungen, auch Neoplasien genannt, die jede Art von Gewebe betreffen können. Sie entstehen durch fehlgesteuerte Prozesse bei der Zellteilung und im Zellwachstum. Unterschieden werden gutartige (benigne) und bösartige (maligne) Tumore. Die Begriffe beziehen sich auf die sogenannte Dignität eines Tumors, also auf sein Wachstumsverhalten (invasiv vs. nicht invasiv) und seine Fähigkeit, Metastasen auszubilden.
- Gutartige Tumore: Gutartige Tumore wachsen lokal begrenzt. Sie sind nicht in der Lage, Metastasen auszubilden und können somit auch nicht streuen. Trotzdem können sie allein aufgrund ihres Volumens große Probleme verursachen (Hirntumore o.ä.).
- Bösartige Tumore: Bösartige Tumore wuchern schnell, unkontrolliert und zerstörerisch in das umliegende Gewebe hinein. Sie sind zudem imstande, über Blut- und Lymphbahnen zu wandern und durch die Bildung von Metastasen andere Teile des Körpers zu besiedeln.
Neben benignen und malignen Tumoren werden noch semimaligne Tumore unterschieden. Sie metastasieren selten oder gar nicht, zeichnen sich aber durch ein zerstörerisches, invasives Wachstum aus und können das vorhandene Gewebe stark schädigen.
Von Sarkoid bis Hämangiosarkom: Welche Tumore beim Pferd können operiert werden?
Die häufigsten Tumore, die bei Pferden vorkommen, betreffen die Haut. Dabei handelt es sich in erster Linie um Sarkoide, Melanome und Plattenepithelkarzinome.
- Sarkoid: Das equine Sarkoid ist der häufigste Hauttumor beim Pferd. Er gilt als gutartig, kann aber stark wachsen und in umliegendes Gewebe eindringen. Er zeigt sich sehr unterschiedlich – von kleinen, verschieblichen Knoten bis zu blutenden, fleischigen Geschwüren – und kann an vielen Stellen auftreten (z. B. Augen, Ohren, Maul, Hals, Brust, Unterbauch, Innenseite der Oberschenkel). Behandelt wird je nach Fall mit Vereisung (Kryotherapie), Medikamenten (Chemo-/Immuntherapie) oder per OP mit Skalpell/Laser. Weil Sarkoide häufig wiederkommen, sollte der Tumor möglichst vollständig entfernt werden.
- Melanom: Ein Melanom ist ein Tumor aus entarteten Pigmentzellen der Haut. Es kommt besonders häufig bei Schimmeln vor, daher der Name „Schimmelkrebs“. Melanome können gut- oder bösartig sein. Bei Schimmeln sind sie meist gutartig, wachsen langsam und streuen selten. Bei Pferden anderer Fellfarben treten häufiger bösartige Formen auf, die schneller wachsen und metastasieren.
Auch gutartige Melanome können Probleme machen: An Schweifrübe und After erschweren sie den Kotabsatz, an Ohrspeicheldrüse und Lippen behindern sie Schlucken und Fressen. Kleine, einzelne Tumoren werden meist operiert; wachsen sie ins Nachbargewebe ein, wird eher bestrahlt. - Plattenepithelkarzinom: Plattenepithelkarzinome entstehen aus hornbildenden Zellen der Oberhaut. Sie zählen zu den bösartigsten Tumoren beim Pferd: Sie wachsen aggressiv, befallen früh Lymphknoten und können streuen. Sichtbar werden sie als schuppige Hautstellen oder Knoten. Häufig betroffen sind die äußeren Genitalien und die Augen (Hornhaut, Bindehaut, Lider), aber auch innere Organe wie Magen oder Harnblase können erkranken. Meist ist eine Operation nötig; die Methode richtet sich nach Ort und Stadium – z. B. Keratektomie bei Hornhautbefall oder bei fortgeschrittenen Tumoren im Genitalbereich eine teilweise bzw. vollständige Amputation.
Lymphome und Hämangiosarkome
Zwar kommt Hautkrebs bei Pferden überdurchschnittlich häufig vor, es gibt aber noch eine Reihe weiterer Tumorarten, an denen Pferde erkranken können. Dazu gehören beispielsweise Lymphome und Hämangiosarkome.
- Lymphom: Lymphome sind meist bösartige Tumore, die in lymphatischen Organen bzw. im Lymphsystem entstehen. Am häufigsten tritt die multizentrische Form auf, die sich auf mehrere Organe erstreckt, meistens Lymphknoten, Milz und Leber. Daneben gibt es noch vier weitere Varianten, die sich in der Lokalisation unterscheiden: Das intestinale Lymphom (Magen-Darm-Trakt), das mediastinale Lymphom (Brustkorb), das zentralnervöse Lymphom (Hirnwasser) und das kutane Lymphom (Haut). Zu den Symptomen zählen geschwollene Lymphknoten, Fieber, Gewichtsverlust, Mattheit und Appetitlosigkeit. Kutane Lymphome äußern sich in Hautveränderungen. Die Behandlungsmöglichkeiten umfassen Chemo- und Strahlentherapie sowie operative Maßnahmen zur Entfernung von lokalen Tumoren. Generell ist ein Lymphom nicht heilbar, sondern kann nur symptomatisch bzw. palliativ behandelt werden.
- Hämangiosarkom: Das Hämangiosarkom ist ein meist bösartiger Gefäßtumor, der von den Zellen der Blutgefäßauskleidung (Endothelzellen) ausgeht. Es verhält sich hochinvasiv, bildet aber erst spät Metastasen aus. Von einem Hämangiosarkom können die Haut und darunterliegende Bereiche wie Faszien und Muskeln, aber auch Organe wie die Milz betroffen sein. Bei Pferden trifft es am häufigsten das Atem- und Muskel-Skelett-System, dementsprechend sind die Symptome sehr variabel und reichen von Atembeschwerden und Nasenbluten über veränderte Schleimhäute bis hin zu schmerzhaften Schwellungen und Lahmheiten. Lokale Tumore an der Haut und Unterhaut werden operativ entfernt. Sind die inneren Organe befallen, stehen die Behandlungschancen jedoch meist schlecht. Ist die Milz betroffen, kann man diese zwar operativ entfernen, hat der Krebs aber bereits in Leber und Lunge gestreut, lässt sich damit nicht viel ausrichten.
Der Vollständigkeit halber seien auch noch Fibrosarkome, Stromatumore und Mastzelltumore genannt. Diese treten bei Pferden jedoch verhältnismäßig selten auf und können mitunter nur schwer operiert werden.
Wie läuft eine Tumoroperation beim Pferd ab?
Der Behandlung geht zunächst einmal eine Diagnose voran. Der Tierarzt oder die Tierärztin wird die Art, Größe, Dignität und Lage des Tumors ermitteln. Dazu werden verschiedene Untersuchungen wie eine Biopsie und bildgebende Verfahren durchgeführt. Anschließend geht es darum, eine geeignete Therapieform zu finden. Nicht jeder Tumor kann auf chirurgischem Weg entfernt werden. Ob eine Operation möglich ist, hängt von seiner Lage ab und davon, inwieweit er sich lokal abgrenzt. Hat er das umliegende Gewebe bereits infiltriert, ist eine operative Entfernung mitunter schwer oder gar nicht durchführbar. Auch Tumore, die im Bereich des Rückenmarks oder Gehirns liegen, können aufgrund ihrer schwierigen Lokalisation oft nicht chirurgisch entfernt werden.
Ist der Tumor operabel, stehen die Erfolgschancen gut und ist das Pferd in geeigneter Verfassung, entscheidet man sich im Regelfall für den chirurgischen Weg. Der Ablauf ist individuell unterschiedlich. Tumore im Bereich des Anus oder Schweifs werden beispielsweise meist im Stehen und unter örtlicher Betäubung entfernt. In vielen Fällen sind Tumoroperationen jedoch umfangreiche Eingriffe, die in der Tierklinik und unter Vollnarkose durchgeführt werden. Sie gehen mit gewissen Risiken für das Pferd einher. So kann es beim Einleiten der Narkose und während des Aufwachens beispielsweise zu Kreislaufproblemen und Verletzungen kommen. Auch Nachblutungen, Infektionen und Wundheilungsstörungen sind möglich. Erfahrung auf Seiten des Tierarztes oder der Tierärztin ist daher sehr wichtig – sowohl was die Anästhesie als auch die operative Praxis betrifft, gerade wenn sich um komplizierte Eingriffe handelt.
Nach der Operation sind eine sorgfältige Nachsorge (Pflege der Wundnaht etc.) und Überwachung unerlässlich. Zu diesem Zweck bleibt das Pferd meist noch einige Tage in der Klinik und wird betreut. Ist das Tier weitgehend stabil und auf einem guten Weg zur Regeneration, kann es entlassen werden.
Wie viel kosten Tumoroperationen beim Pferd?
Tumoroperationen beim Pferd können mit hohen Kosten verbunden sein. Das liegt zum einen darin begründet, dass es sich oft um anspruchsvolle Eingriffe handelt. Hinzu kommt, dass auch Medikamente, Verbandsmaterial, Vorsorge, Nachsorge und der Klinikaufenthalt mit Verpflegung bezahlt werden müssen. Dementsprechend können schnell Kosten von mehreren Tausend Euro entstehen. Die Pferde-OP- und Pferdekrankenversicherungen der Uelzener bieten in solchen Fällen finanziellen Schutz. Sie erstatten bis zu 100 % der Kosten für Operationen und weitere Leistungen, die mit dem Eingriff in Zusammenhang stehen. So kann das Pferd bestmöglich versorgt werden.
Fazit
Tumoroperationen beim Pferd sind ein wichtiger Bestandteil der tiermedizinischen Therapie. Die Erfolgsaussichten hängen maßgeblich von der Art, Größe und Lage des Tumors, dem allgemeinen Gesundheitszustand des Pferdes und auch von einer frühzeitigen Diagnose ab. Denn: Hat der Krebs bereits gestreut oder umliegendes Gewebe infiltriert, ist ein chirurgischer Eingriff oft nicht mehr ohne weiteres möglich oder sinnvoll. Entscheidend für den Behandlungserfolg sind eine gründliche Diagnostik, Erfahrung auf Seiten des tierärztlichen Teams und eine sorgfältige Nachsorge. Auch wenn das Narkoserisiko und mögliche Komplikationen nicht zu unterschätzen sind, überwiegt der Nutzen einer Operation jedoch in vielen Fällen.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Thema Tumoroperationen bei Pferden
Wann ist eine Tumoroperation beim Pferd sinnvoll?
Eine Operation ist sinnvoll, wenn der Tumor gut zugänglich, klar abgrenzbar und (zumindest lokal) begrenzt ist. Das ist meist der Fall bei gutartigen oder langsam wachsenden Tumoren sowie bei frühen Stadien bösartiger Veränderungen.
Wie lange dauert die Heilung nach der Operation?
Die Wundheilung dauert meist zwei bis sechs Wochen, abhängig vom Umfang der Naht, der Lokalisation und dem Allgemeinzustand des Pferdes. Boxenruhe, Verbandswechsel und tierärztliche Kontrolle sind während dieser Zeit essenziell.
Können Tumore nach einer OP wiederkommen?
Ja, das Risiko eines Rezidivs besteht, vor allem bei Sarkoiden. Deswegen ist es wichtig, den Tumor vollständig zu entfernen.
Muss jeder Tumor beim Pferd operiert werden?
Nicht jeder Tumor ist behandlungsbedürftig. Einige Tumore wachsen sehr langsam und verursachen keine Beschwerden. In solchen Fällen kann es ausreichen, das Tier zu beobachten oder auf alternative, weniger invasive Therapien zurückzugreifen.
Kann mein Pferd nach der OP wieder normal geritten werden?
Wenn die OP komplikationslos verläuft und der Tumor keine wichtigen Strukturen (Gelenke, Sehnen etc.) beeinträchtigt hat, kann das Pferd wieder normal geritten werden. Nach der OP muss jedoch zunächst eine Reitpause eingelegt werden – für die Wundheilung und Regeneration.