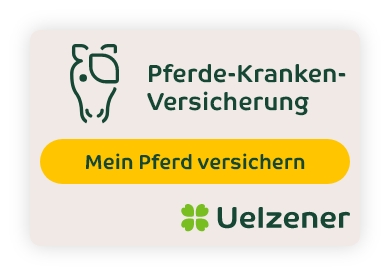PSSM steht für Polysaccharid-Speicher-Myopathie (Polysaccharide Storage Myopathy) und bezeichnet eine fortschreitende Erkrankung der Skelettmuskulatur, die bei Pferden relativ häufig vorkommt und genetisch bedingt ist. Unterschieden werden zwei Typen: der PSSM Typ 1 und MIM (vormals PSSM Typ 2). Beide Formen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Muskulatur des Pferdes instabil wird und degeneriert, was mit starken Schmerzen und Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats einhergehen kann. Zwar sind weder PSSM 1 noch MIM heilbar, allerdings lässt sich durch eine angepasste Fütterung und Haltung sowie ein gezieltes Bewegungstraining einiges ausrichten, um betroffenen Tieren wieder zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. In unserem Artikel erfährst du mehr über den Hintergrund, die Symptomatik und Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung.
Was ist eine PSSM?
Um zu verstehen, was PSSM eigentlich bedeutet, muss man sich mit der Funktionsweise des Muskelstoffwechsels befassen. Damit die Muskeln ihre Funktion erfüllen können, benötigen sie Energie, die zu einem großen Teil von Kohlenhydraten zur Verfügung gestellt wird. Diese nehmen Pferde hauptsächlich über die Nahrung auf, sei es durch Heu, Gras oder Kraftfutter. Im Dünndarm werden die Kohlenhydrate zum Einfachzucker Glukose umgewandelt, der vom Körper sehr gut verwertet werden kann. Ein Teil davon entfällt auf Gehirn und Nervenzellen. Der andere Teil gelangt ins Blut und bewirkt einen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Infolgedessen wird Insulin ausgeschüttet. Das Hormon senkt den Blutzuckerspiegel, indem es dafür sorgt, dass die Glukose in die Körperzellen gelangt und für die Energiegewinnung genutzt werden kann. Es heftet sich als Rezeptor an die Zellen an, um den Blutzucker einzuschleusen. In den Muskelzellen wird die Glukose zu Glykogen, einem Mehrfachzucker (Polysaccharid), umgewandelt. Glykogen ist eine Speicherform von Glukose und wird bei Bedarf freigesetzt. Muss der Muskel Arbeitsleistung erbringen, wird das Glykogen wieder zu Glukose abgebaut. Dabei entsteht Energie, die der Muskel nutzen kann.
Erkrankt ein Pferd an PSSM, funktioniert der Muskelstoffwechsel nicht richtig. Die Muskelzellen reagieren schon auf Kleinstmengen an ausgeschüttetem Insulin. Sie nehmen dadurch mehr Glukose auf und speichern bis zu vier Mal so viel Glykogen, was Pferde selbst bei andauernder körperlicher Belastung nicht verbrauchen könnten. Da über die Nahrung weiterer Zucker zugeführt wird, steigt der Energievorrat immer weiter an, allerdings ist die Speicherkapazität der Muskelzellen begrenzt. Die überschüssige Energie wird infolgedessen in Stärke umgewandelt, die jedoch nicht für die Energiegewinnung herangezogen werden kann. In der Folge entsteht ein Energiemangel, obwohl ursprünglich ein Überschuss existierte. Durch diesen Mangel können die Muskeln ihre Funktion nicht mehr erfüllen und degenerieren.
PSSM 1 und MIM
Die Polysaccharid-Speicher-Myopathie ist genetisch bedingt und zählt zu den häufigsten Muskelerkrankungen bei Pferden. Ursprünglich wurden zwei Typen differenziert: PSSM 1 und PSSM 2. Heute weiß man jedoch, dass es sich beim zweiten Typ genau genommen nicht um eine Speicher-Myopathie, sondern um eine Belastungs-Myopathie handelt, da hier keine grundlegende Störung des Kohlenhydratstoffwechsels vorliegt. Aus diesem Grund spricht man nicht mehr von PSSM 2, sondern von MIM (Muskel-Integritäts-Myopathie). Hier die Unterschiede und Spezifika der beiden Varianten im Überblick:
- PSSM 1: PSSM 1 ist auf eine Mutation des Gens GYS1 zurückzuführen. Dieses Gen codiert das Enzym Glykogen-Synthase, das an dem Umbau von Glukose zu Glykogen beteiligt ist. Aufgrund des Gendefekts ist das Enzym überaktiv, wodurch immer mehr Glykogen in den Muskelzellen entsteht. Das wird dadurch begünstigt, dass aufgrund der erhöhten Insulinempfindlichkeit der Muskelzellen mehr Blutzucker eingeschleust wird.
- MIM: MIM ist derzeit noch nicht umfassend erforscht. Es gibt mehrere Varianten (P2, P3, P4, P8 usw.), die auf Veränderungen verschiedener Gene zurückzuführen sind, die Proteine der Skelettmuskulatur codieren. Bei den Varianten P2, P3 und P4 beispielsweise sind Strukturproteine betroffen. Sie sind nicht mehr in der Lage, den Sarkomeren Stabilität zu verleihen, so dass die gesamte Muskelzelle instabil wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei PSSM 1 um eine stoffwechselbedingte Speicher-Myopathie mit einer eindeutigen genetischen Ursache (GYS1-Mutation) handelt. Eine MIM ist dagegen eine strukturelle Muskelstörung, bei der bestimmte Proteine in den Muskelfasern aufgrund genetischer Defekte fehlerhaft codiert werden und ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Dennoch haben PSSM 1 und MIM eine ähnliche Symptomatik. Sie sind zwar nicht heilbar, können aber mit dem richtigen Fütterungs- und Bewegungsmanagement gut behandelt werden.
Wie wird PSSM vererbt und welche Rassen sind betroffen?
Die Vererbbarkeit von MIM ist bislang nicht ausreichend untersucht. Bei PSSM 1 lässt sich jedoch sagen, dass die Mutation autosomal-dominant und sowohl homozygot (beide Elternteile sind belastet) als auch heterozygot (ein Elternteil ist belastet) vererbt wird. Ist nur ein Elternteil belastet, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Gendefekt an die Nachkommen weitergegeben wird, bei 50 %. Die Erkrankung muss jedoch nicht zwangsläufig ausbrechen. Geben beide Elternteile das Gen weiter, ist eine Erkrankung der Nachkommen so gut wie sicher.
Besonders häufig von PSSM betroffen sind gut bemuskelte und robuste Pferde wie Quarter Horses, Paint Horses und Kaltblüter. Grundsätzlich können jedoch alle Pferderassen daran erkranken. So wurde PSSM beispielsweise auch bei Haflingern, Freibergern und verschiedenen Warmblütern nachgewiesen. Generell können Pferde aller Altersstufen erkranken, wobei das Risiko bei Fohlen und Jungpferden geringer ist. Die ersten Schübe treten meist in einem Alter zwischen 7 und 10 Jahren auf.
Welche Symptome sind typisch für eine PSSM?
Die Symptome von PSSM ähneln denen eines Kreuzverschlags, einer Erkrankung der Rückenmuskulatur, die ebenfalls auf einen Überschuss an Glykogen in den Muskelzellen zurückzuführen ist. Problematisch ist hier, dass nicht genügend Sauerstoff für die Abtransport von Abbauprodukten wie Laktat bereitgestellt werden kann, wodurch die Muskeln übersäuern und zerstört werden.
Typische Anzeichen für eine PSSM sind:
- Muskelschmerzen (moderat bis sehr stark)
- Muskelsteifheit
- Muskelzittern
- Bewegungsunwilligkeit
- starkes Schwitzen
- Harnabsatzstellung (ohne zu urinieren)
- verhärtete Kruppen- und Rückenmuskulatur
- geringe Leistungsbereitschaft
- steife oder schwache Hinterhand
- veränderter, ataktischer Gang
- Lahmheit
- Koordinationsschwierigkeiten
- Muskelschwund (erkennbar an Dellen im Hinterhand-, Schulter- und Rückenbereich)
- Absetzen von rost-/dunkelrotem Harn
- Festliegen
Generell treten Symptome einer PSSM meist schubweise auf, wobei sich der Zustand des Pferds nach und nach verschlechtert. Es hat immer weniger Bewegungsfreude, leidet an Schmerzen und verliert Gewicht. Wichtig zu wissen ist, es sich bei Schüben mit schweren Symptomen wie dunkelrotem Harn oder Festliegen um einen medizinischen Notfall handelt. Das Pferd muss dann umgehend tierärztlich versorgt werden. Eine Pferdekrankenversicherung schützt vor finanziellen Risiken, so dass dem Tier eine optimale Behandlung zukommen kann.
Zur Diagnose von PSSM beim Pferd
PSSM 1 kann mit einem validen Gentest sicher diagnostiziert werden. Dazu wird dem Tier eine Blut- oder Haarprobe aus Mähne oder Schweif entnommen und ans Labor geschickt. Für MIM bzw. deren Varianten werden zwar diverse Gentests angeboten, allerdings ist keiner davon offiziell validiert. Hier kann nur eine Muskelbiopsie verlässliche Ergebnisse liefern.
Ein Blutbild ist im Fall einer PSSM weniger aufschlussreich. Hier werden bei einem akuten Schub die Werte der Muskelenzyme Creatinkinase (CK) und Aspartattransaminase (AST) gemessen. Diese liegen bei Pferden mit PSSM schon im Ruhezustand über dem Normalwert und steigen unter Belastung um ein Vielfaches an. Allerdings passiert das auch, wenn das Pferd unter Stress steht. Hat es beispielsweise Angst vor dem Blutabnehmen, kann das die Messwerte verfälschen.
PSSM beim Pferd behandeln – So geht’s!
PSSM 1 und MIM sind nicht heilbar. Es gibt jedoch Möglichkeiten, dem Pferd Linderung zu verschaffen und wieder zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Medikamente spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Zwar kann die Verabreichung von schmerzlindernden und entzündungshemmenden Mitteln während akuter Schübe durchaus sinnvoll sein, sofern sie mit dem Tierarzt oder der Tierärztin abgesprochen sind, langfristig gesehen lässt sich damit jedoch wenig ausrichten. Fütterung und Haltung kommen in dem Zusammenhang eine viel größere Bedeutung zu. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Fütterung
- Bei Pferden mit PSSM 1 ist eine stärke- und zuckerreduzierte Ernährung wichtig, damit möglichst wenig Glykogen in den Zellen gebildet wird.
- Für Pferde mit MIM ist eine stärke- und zuckerreduzierte Kost nicht notwendig, da keine Stoffwechselstörung vorliegt.
- Bei beiden Varianten sollte der Fokus auf hochwertigen Proteinen liegen, um den Erhalt und Aufbau der Muskeln zu unterstützen.
- Hochwertiges Raufutter sollte bei PSSM 1 und MIM Basis der Fütterung sein.
- Ein Mineralfutter, das dem Pferd wichtige Vitamine und Mineralstoffe liefert, kann ebenfalls sinnvoll sein.
Haltung:
- Bewegung an der frischen Luft ist für Pferde mit PSSM 1 und MIM gleichermaßen wichtig. Unterschiede gibt es im Hinblick auf den Weidegang und Stehzeiten.
- AN PSSM 1 erkrankte Pferde sollten reglementierten Weidezugang haben, damit sie nicht zu viel reichhaltiges Gras fressen. Gut ist, wenn das Pferd täglich moderat bewegt wird. Stehtage und Boxenruhe sind kontraproduktiv.
- Bei Pferden mit MIM müssen die Weidezeiten nicht zwingend eingeschränkt werden. Regelmäßige Bewegung ist wichtig, es empfiehlt sich jedoch ein reitfreier Tag pro Woche.
- Bei beiden Varianten sollte das Training dem Leistungsniveau entsprechen und ausreichend lange Aufwärmphasen beinhalten. Stress und Belastungsspitzen gilt es zu vermeiden.
Grundsätzlich lässt sich mit einem durchdachten Fütterungs- und Bewegungsmanagement sehr viel ausrichten, um die Lebensqualität erkrankter Tiere zu verbessern. Die Prognosen stehen gut, so dass ein Pferd mit PSSM durchaus wieder als Reit- oder Sportpferd genutzt werden kann. Trotzdem muss einem bewusst sein, dass die Maßnahmen das ganze Pferdeleben lang durchgeführt werden müssen.
Fazit
PSSM beim Pferd ist eine ernstzunehmende Muskelerkrankung, die für betroffene Tiere mit starken Schmerzen verbunden sein kann. Unterschieden werden zwei Varianten, die zwar nicht dieselbe Ursache haben, sich jedoch in der Symptomatik ähneln. Beide Ausprägungen sind erblich bedingt und nicht heilbar, lassen sich aber durch angepasste Fütterungs-, Trainings- und Haltungsbedingungen gut in den Griff kriegen, so dass das Pferd noch viele schöne Jahre verleben kann.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Thema PSSM bei Pferden
Warum ist der Harn bei PSSM-Pferden dunkelrot?
Bei starken Schüben kann es vorkommen, dass PSSM-erkrankte Pferde dunkel- oder rostroten Harn ausscheiden. Die Färbung ist auf das Muskeleiweiß Myoglobin zurückzuführen. Es wird auch als „roter Muskelfarbstoff“ bezeichnet, da es den Muskeln ihre rote Farbe verleiht. Bei einer Schädigung des Muskelgewebes tritt Myoglobin aus, wird ins Blut freigesetzt und über Nieren ausgeschieden. Auf diese Weise gelangt es in den Urin und färbt ihn dunkelrot.
Wie lange leben Pferde mit PSSM?
Erkrankt ein Pferd an PSSM 1 oder MIM, muss das die Lebenserwartung nicht zwingend einschränken. Entscheidend ist, dass die Myopathie frühzeitig erkannt und richtig behandelt wird.
Was versteht man unter Einzelträgern und Doppelträgern?
PSSM ist erblich bedingt und auf einen Gendefekt zurückzuführen. Als Einzelträger bezeichnet man ein Pferd, das den Gendefekt nur von einem Elternteil geerbt hat. Doppelträger haben den Defekt von beiden Elternteilen geerbt. Das Risiko einer Erkrankung ist in dem Fall sehr groß.