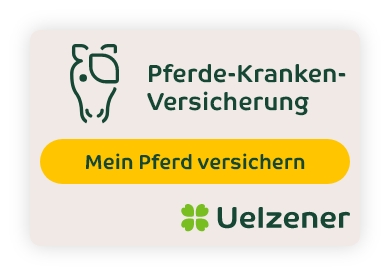Der Herbst läutet nicht nur die dunkle Jahreszeit ein, sondern bringt auch Dauerregen, Nebel und Kälte mit sich. Für Pferde, die sich überwiegend im Freien aufhalten, kann das zu einer Herausforderung werden. Das gilt vor allem für Tiere, die mit einem langen oder sehr dichten Haarkleid ausgestattet sind. Zwar schützt ein warmes Fell vor Kälte und Nässe, irgendwann setzt sich die Feuchtigkeit jedoch in den Haaren fest, wodurch die darunterliegende Haut aufweicht und ein feuchtwarmes Milieu entsteht. Bakterien können sich dann schnell vermehren und über Mikroläsionen in die Haut eindringen. Eine mögliche Folge davon ist Dermatophilose, auch Regenräude genannt. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Hautinfektion, die vor allem den Bereich der Kruppe, die Gliedmaßen, den Rücken und Hals betrifft und sich in schweren Fällen auf den gesamten Körper erstrecken kann. Sie verursacht Hautentzündungen, die aufbrechen und für betroffene Tiere sehr schmerzhaft sein können. In unserem Artikel erfährst du mehr zu den Ursachen, der Symptomatik und den Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung.
Zur Entstehung von Dermatophilose
Dermatophilose wird durch das Bakterium Dermatophilus congolensis hervorgerufen, das auf direktem oder indirektem Wege übertragen werden kann. Zu einer Infektion kommt es meistens dann, wenn die Haut vorgeschädigt ist und durch anhaltende Nässe überstrapaziert wird. Hier treffen mehrere ungünstige Faktoren zusammen: Über Mikrotraumata in der Haut, beispielsweise durch Insektenstiche oder -bisse verursacht, können die Bakterien in den Organismus eindringen. Zusätzlich wird die Hautbarriere durch den permanenten Kontakt mit Feuchtigkeit geschwächt.
Gerade Dauerregen, der sich in manchen Gegenden über Wochen oder Monate hinziehen kann, ist problematisch. Fett und Talg, die eigentlich eine Art Schutzschicht bilden, werden regelrecht herausgespült. Da die Haut nie vollständig durchtrocknet, kann sie die schützenden Lipide nicht in ausreichendem Maß nachproduzieren. Dadurch trocknet sie aus und bildet Mikrorisse, die ein weiteres Einfallstor für Bakterien darstellen. Hinzu kommt, dass durch die Nässe von außen und die Körperwärme von innen ein feuchtwarmes Milieu im Fell entsteht. Dieses bietet den Bakterien einen hervorragenden Nährboden.
Symptome und Verlauf einer Dermatophilose
Eine Dermatophilose entsteht meistens durch die Kombination aus Hautläsionen und anhaltender Nässe, aus diesem Grund wird sie auch als „Regenräude“ oder „Regenekzem“ bezeichnet. Sobald die Bakterien in die Haut eingedrungen sind, wandern sie tiefer in die Mikroläsionen hinein. Da es sich bei Dermatophilus congolensis um ein anaerobes Bakterium handelt, gedeiht es unter Sauerstoffmangel besten. Demzufolge vermehrt es sich unter Luftabschluss in den tieferen Hautschichten exponentiell.
An der Hautoberfläche bilden sich zunächst Schwellungen, Rötungen und Pusteln. Diese können bei Pferden mit sehr dichtem oder langem Fell jedoch lange unbemerkt bleiben. Die Entzündung schreitet dann weiter voran und breitet sich unter der Haut aus. Irgendwann brechen die Infektionsherde auf, so dass nässende und eiternde Wunden entstehen. Sie werden spätestens dann sichtbar, wenn das darüberliegende Fell ausfällt. Die offenen Stellen verursachen nicht nur große Schmerzen, sondern belasten auch das Immunsystem. Viele Pferde entwickeln Fieber, was den Organismus zusätzlich schwächt. Bleibt die Infektion unbehandelt, verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Tiers zunehmend.
Die Symptome einer Dermatophilose im Überblick:
- Hautrötungen und -schwellungen
- Wärmeentwicklung betroffener Partien
- Pusteln und Papeln, vor allem an Rücken, Hals, Gliedmaßen und Kruppe
- Aufbrechende, nässende Wunden, eitrige Geschwüre
- Verkrustungen, Schorfbildung und Verhärtungen
- Haarausfall an den betroffenen Stellen
- Fieber
- Berührungsempfindlichkeit, Schmerzhaftigkeit
- Appetitlosigkeit, Nervosität und Unruhe aufgrund der Schmerzen
Wenn sich solche oder ähnliche Symptome beim Pferd zeigen, sollte schnellstmöglich tierärztlicher Rat eingeholt werden. Medizinische Hilfe ist wichtig, um dem Tier Strapazen zu ersparen und ihm wieder zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen.
Dermatophilose versus Hautpilz und Mauke: Das sind die Unterschiede
Dermatophilose, Mauke und Hautpilz sind Hauterkrankungen bei Pferden, die teils ähnliche Symptome hervorrufen. Aus diesem Grund kann man sie durchaus miteinander verwechseln. Wir geben einen Überblick über die Unterschiede: Eine Dermatophilose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die vorrangig durch die Kombination aus Nässe und Mikrotraumata der Haut entsteht. Sie ist für betroffene Tiere sehr schmerzhaft. Ein Juckreiz tritt nicht auf. Betroffen sind vor allem der Rücken, die Kruppe, die Gliedmaßen und der Hals.
Als Mauke bezeichnet man eine Hautentzündung der Fesselbeuge, die sich ebenfalls in nässenden Wunden und Krustenbildung äußern und im weiteren Verlauf über weite Teile des unteren Bewegungsapparats erstrecken kann. Die Ursachen sind vielfältig. So kann Mauke beispielsweise durch Bakterien, Pilze oder Parasiten entstehen und wird zusätzlich durch UV-Strahlung, den Kontakt mit Schmutz, Kot oder anderen hautreizenden Stoffen begünstigt. Die Primärinfektion verursacht häufig einen Juckreiz. Durch das Kratzen kommt es zu weiteren Hautläsionen, was ein Risiko für Sekundärinfektionen mit sich bringt. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Auslösern gibt es für Mauke keine Universaltherapie. Die Behandlung muss stets auf den Einzelfall abgestimmt werden.
Dermatomykosen bzw. Dermatophytosen werden durch Pilze verursacht, allen voran von den Arten Microsporum und Trichophyton. Begünstigende Faktoren sind Wärme, Feuchtigkeit, eine geschwächte Hautbarriere und eine schwache Immunabwehr. Zu den typischen Symptomen zählen Papeln, Schuppen, Krustenbildung und Haarausfall. Vor allem im Anfangsstadium kann man eine Dermatophilose leicht mit Hautpilz verwechseln. Deswegen ist es wichtig, eine sichere Diagnose zu stellen, um eine geeignete Behandlung wählen zu können. Hautpilz bei Pferden kann sich direkt (von infiziertem zu nicht-infiziertem Individuum) oder indirekt (über Ausrüstung wie Satteldecken, Bürsten etc.) übertragen. Da es sich um eine Zoonose handelt, kann die Erkrankung auch auf andere Tiere und den Menschen übergehen.
Dermatophilose diagnostizieren und behandeln
Bei Verdacht auf Dermatophilose solltest du dein Pferd umgehend tierärztlich durchchecken lassen. Um eine sichere Diagnose zu erstellen, wird ein Hautgeschabsel entnommen und unter dem Mikroskop untersucht. Aufgrund seiner geldrollenartigen Struktur ist das Bakterium relativ leicht zu erkennen. Kann es nachgewiesen werden, schließt sich eine kulturelle Anzucht an. In dem Fall wird das Bakterium unter Laborbedingungen vermehrt, um eine Empfindlichkeitsprüfung durchzuführen. Das hilft dabei, ein geeignetes Antibiotikum zu wählen.
Bei der Behandlung einer Dermatophilose geht es in erster Linie darum, die Auslöser zu eliminieren. Das heißt: Das Pferd darf keiner Nässe mehr ausgesetzt werden, damit Haut und Fell vollständig durchtrocknen und sich regenerieren können. Zur Behandlung der Wunden empfehlen sich antibakterielle Shampoos oder Sprays. Damit werden die Hautpartien vorsichtig gereinigt sowie verklebtes Sekret und Krusten vorsichtig entfernt. Wichtig: Auch hiernach muss das Tier vollständig trocknen. Es ist sinnvoll, das Fell zu trimmen oder zu scheren, damit sich keine weitere Feuchtigkeit ansammeln kann und die Wunden besser zugänglich sind.
Folgende Maßnahmen sind empfehlenswert:
- Pferd ins Trockene holen (Unterstand oder Box)
- Bei gutem Wetter nach draußen bringen: Sonnenlicht und frische Luft unterstützen die Heilung
- Putzzeug und Ausrüstung vor jedem Gebrauch reinigen und desinfizieren, um eine erneute Infektion zu vermeiden
- Satteldecken, Abschwitzdecken etc. heiß waschen
- Betroffene Hautstellen mit Ekzemer-Shampoo, antibiotischen Sprays oder Kernseife vorsichtig reinigen
- Verkrustungen und verklebtes Sekret sanft entfernen (am besten beim Reinigen vorher einweichen) und Wunden anschließend desinfizieren
- Bei jedem Kontakt Einweghandschuhe anziehen und diese gemeinsam mit Behandlungsmaterialen (Wundreinigungstücher etc.) nach Gebrauch entsorgen: Sauberkeit ist das A und O
Die Behandlung einer Dermatophilose kann aufwendig sein und mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Zu Beginn werden die Wunden täglich gereinigt, danach ein oder zwei Mal pro Woche – je nach ärztlicher Absprache. Sollte sich der Zustand des Pferdes nicht verbessern, muss es erneut dem Tierarzt oder der Tierärztin vorgestellt werden. Dann kann es sein, dass eine systemische Antibiotikatherapie erforderlich ist. Um im Fall der Fälle Sicherheit zu haben, empfiehlt sich eine Pferdekrankenversicherung. Sie übernimmt die Kosten für Diagnose- und Behandlungsmaßnahmen und schützt auf diese Weise vor finanziellen Belastungen.
Dermatophilose vorbeugen
Um einer Dermatophilose vorzubeugen, ist es wichtig, das Pferd vor permanenter Feuchtigkeit zu schützen. Ein paar Tage Regen machen den meisten Tieren nichts aus. Problematisch wird es, wenn der Regen Wochen oder Monate andauert und es keine Möglichkeit gibt, Fell und Haut vollständig durchzutrocknen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, das Pferd bei Regen in einen trockenen Unterstand oder in die Box zu holen. Wichtig dabei ist, Gamaschen und Hufglocken abzunehmen, damit sich darunter keine Feuchtigkeit anstaut. Wenn das Pferd zeitweise draußen steht, kann man ihm eine wasserdichte Decke überlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Fell darunter trocken ist und alle Risikobereiche (Kruppe, Gliedmaßen, Hals, Rücken) abgedeckt sind. Empfehlenswert ist auch, empfindliche Stellen mit einem Balsam einzureiben, der der Haut zusätzlichen Schutz bietet.
Generell sind Pferde mit geschwächtem Immunsystem anfälliger für eine Infektion. Aus diesem Grund muss in besonderem Maß auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung und prophylaktische Maßnahmen wie regelmäßige Entwurmungen geachtet werden.
Fazit
Dermatophilose ist eine Hauterkrankung, die vor allem in der kalten und feuchten Jahreszeit auftritt. Sie wird durch Bakterien verursacht und betrifft insbesondere Pferde mit langem und dichtem Fell. Da das Haarkleid schlechter trocknet, weicht die darunterliegende Haut auf und wird in ihrer Schutzfunktion geschwächt, wodurch Bakterien leichtes Spiel haben. Eine Erkrankung kann für Pferde sehr unangenehm und schmerzhaft sein, denn früher oder später brechen die Infektionsherde auf und bilden nässende, offene Wunden. Es ist daher wichtig, tierärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, sobald sich Symptome zeigen. Mit der richtigen Therapie heilt Dermatophilose in der Regel gut ab – entscheidend ist, die Haut konsequent zu behandeln und im Nachgang zu stärken, um Rückfälle zu vermeiden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Thema Dermatophilose beim Pferd
Wann ist die Gefahr für Dermatophilose am größten?
Dermatophilose tritt insbesondere in der nasskalten Jahreszeit auf, also von Herbst bis Frühling. Aus diesem Grund wird sie auch als Regenräude oder Regenekzem bezeichnet.
Ist Dermatophilose ansteckend?
Ja, aber nicht hochgradig. Der Erreger kann durch direkten Hautkontakt von Tier zu Tier und von Tier zu Mensch übertragen werden, allerdings nur, wenn die Haut des nicht-infizierten Individuums lädiert ist. Bei intakter Haut kann das Bakterium nichts ausrichten. Das Risiko einer Übertragung ist also gering. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, weshalb es sich empfiehlt, bei Kontakt mit einem erkrankten Pferd Hygienemaßnahmen zu ergreifen und es von anderen Tieren zumindest in der Anfangszeit zu separieren.
Kann ich mein Pferd weiterhin reiten?
Das kommt auf den Schweregrad an. Hat das Pferd Schmerzen oder offene Wunden, sollte auf das Reiten in jedem Fall verzichtet werden, bis die Haut verheilt ist.
Sollte man die Krusten entfernen oder dranlassen?
Leicht lösbare Krusten dürfen vorsichtig entfernt werden. Das ist insofern sinnvoll, als sie den Zugang zu den Bakterienherden eröffnen, die dann antibiotisch behandelt werden können. Wichtig ist, nicht an den Krusten zu ziehen oder zu reißen und hygienisch vorzugehen (Handschuhe tragen, Wunde im Anschluss desinfizieren).
Darf das Pferd bei Regen auf die Weide?
Während einer akuten Erkrankung sollte sich das Pferd nicht im Regen aufhalten. Sobald die Haut verheilt ist, kann der Weidegang wieder normal stattfinden.